Einleitung
Bilder zum
Vergrößern bitte anklicken
Das kostbare Gut Zeit ist längst billigst zu
haben: Kaum ein Discounter, der nicht regelmäßig mit
Superpreisknüllern für das Handgelenk aufwartet, modisch in Bicolor für
die Dame oder für den Herren digitaltechnisch aufgerüstet mit Weltzeit,
Kalender, Temperatur- und Biorhythmusanzeige sowie zwölf
Stoppuhrfunktionen. Kreuzworträtselgewinnern winken weltallgesteuerte
Funkuhren mit atomgenauer Weckzeitautomatik, neuen Zeitschriftenabonnenten
chronographische Prämien mit Designeranspruch. Hinter Ziffernblättern
oder Displays werkeln wacker die Batteriepillen, deren Austausch nach
einem Jahr zum Anlass genommen wird, zum nächsten Handgelenk aufwartet, modisch in Bicolor für
die Dame oder für den Herren digitaltechnisch aufgerüstet mit Weltzeit,
Kalender, Temperatur- und Biorhythmusanzeige sowie zwölf
Stoppuhrfunktionen. Kreuzworträtselgewinnern winken weltallgesteuerte
Funkuhren mit atomgenauer Weckzeitautomatik, neuen Zeitschriftenabonnenten
chronographische Prämien mit Designeranspruch. Hinter Ziffernblättern
oder Displays werkeln wacker die Batteriepillen, deren Austausch nach
einem Jahr zum Anlass genommen wird, zum nächsten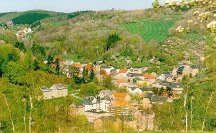 Supersonderpreisknüller
zu greifen: Die Welt der Zeitmesser wird vom Massenprodukt Uhr beherrscht,
in Großserien hergestellt für den globalen Verkauf. Supersonderpreisknüller
zu greifen: Die Welt der Zeitmesser wird vom Massenprodukt Uhr beherrscht,
in Großserien hergestellt für den globalen Verkauf.
Die ganze Welt der Zeitmesser? Nein. Ein kleines, unbeugsames sächsisches Dorf
leistet dem batteriegeladenen Zeitgeist Widerstand: Dort, wo der Prießnitzbach in die Müglitz mündet,
liegt an Berghängen, nicht mehr fern der tschechischen Grenze, das legendäre
Glashütte. Einst war der Ort bekannt für die “Hütte, die
das glänzende Metall abbaut". Das ist allerdings 500 Jahre her, die
Silbervorkommen sind längst erschöpft. Vor dreihundert Jahren wurde in
Glashütte nur noch Stroh geflochten, und vielleicht wäre das noch heute
so, hätten die Glashütter mit Hilfe der damaligen Staatsregierung und
eines engagierten Uhrenmachers sich nicht auf eine zukunftsweisende
Unternehmung eingelassen.

Die
Uhrenindustrie in Glashütte
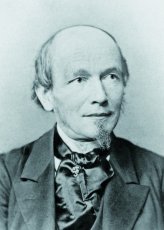 Wer etwas über Glashütte erfahren möchte, wird
unweigerlich auf die Geschichte des Dresdner Uhrmacher
Ferdinand
Adolph Lange stossen. Er war Lehrling des Hofuhrenmachers Friedrich
Gutkaes und Schüler der Technischen Bildungsanstalt, einer Vorgängerin
der heutigen Technischen Universität Dresden. Lange war in Paris sowie in
der Schweiz tätig und hatte dort gesehen, wie die Herstellung
hochwertiger Uhren in den armen Dörfern der Schweizer Jura der Bevölkerung
zu Wohlstand verholfen hatte. Mit einer Fülle neuer Ideen kehrte er in
die Kunstuhrenfabrik Gutkaes zurück, heiratete dessen Tochter Antonia und
wurde Teilhaber und uhrmacherischer Motor im Betrieb des Schwiegervaters.
Nach langen Verhandlungen mit dem königlich-sächsischen Ministerium des
Innern kam ein Vertrag zustande, in dem sich Lange verpflichtete, 15
Jugendliche aus Glashütte zu Uhrmachern auszubilden. Der Staat stellte
einen rückzahlbaren Vorschuss von 7820 Talern bereit. Am 7. Dezember 1845
eröffnete Wer etwas über Glashütte erfahren möchte, wird
unweigerlich auf die Geschichte des Dresdner Uhrmacher
Ferdinand
Adolph Lange stossen. Er war Lehrling des Hofuhrenmachers Friedrich
Gutkaes und Schüler der Technischen Bildungsanstalt, einer Vorgängerin
der heutigen Technischen Universität Dresden. Lange war in Paris sowie in
der Schweiz tätig und hatte dort gesehen, wie die Herstellung
hochwertiger Uhren in den armen Dörfern der Schweizer Jura der Bevölkerung
zu Wohlstand verholfen hatte. Mit einer Fülle neuer Ideen kehrte er in
die Kunstuhrenfabrik Gutkaes zurück, heiratete dessen Tochter Antonia und
wurde Teilhaber und uhrmacherischer Motor im Betrieb des Schwiegervaters.
Nach langen Verhandlungen mit dem königlich-sächsischen Ministerium des
Innern kam ein Vertrag zustande, in dem sich Lange verpflichtete, 15
Jugendliche aus Glashütte zu Uhrmachern auszubilden. Der Staat stellte
einen rückzahlbaren Vorschuss von 7820 Talern bereit. Am 7. Dezember 1845
eröffnete
Lange
in Glashütte zuerst eine Lehrwerkstatt, um sein
Stammpersonal für die zukünftige Uhrenmanufaktur auszubilden. Nach der
Heranbildung einheimischer Uhrmacher gründete Lange ein eigenes Werk.
Viele Spezialwerkstätten für die Steine-, Schrauben-, Räder-,
Federhaus-, Unruh- und Zeigerherstellung folgten, und bald wandelten Hunderte
von sicheren Arbeitsplätzen die Not des Dorfes.

 Das familieneigene Werk übernehmen nach dem Tod
des Vaters die Söhne Richard und Emil, unter deren Regie wahre Kunstwerke
der Zeitmessung in Form berühmter Taschenuhren mit Komplikationen wie
Minutenrepetition, Doppelchronographie, Ewigen Kalendarium und
Mondphasenanzeige entstehen. Der Ruhm des Ortes wächst, bald arbeitet die
Glashütter, einst “Burschen aus rauhen Berufen", an hochwertigen
Kompensationsunruhen für Observatorien und Marinechronometern. Mit der Gründung
der Deutschen Uhrmacherschule im Jahr 1878 wird Glashütte endgültig zum
internationalen Mekka des feinen Uhrenbaus. Das familieneigene Werk übernehmen nach dem Tod
des Vaters die Söhne Richard und Emil, unter deren Regie wahre Kunstwerke
der Zeitmessung in Form berühmter Taschenuhren mit Komplikationen wie
Minutenrepetition, Doppelchronographie, Ewigen Kalendarium und
Mondphasenanzeige entstehen. Der Ruhm des Ortes wächst, bald arbeitet die
Glashütter, einst “Burschen aus rauhen Berufen", an hochwertigen
Kompensationsunruhen für Observatorien und Marinechronometern. Mit der Gründung
der Deutschen Uhrmacherschule im Jahr 1878 wird Glashütte endgültig zum
internationalen Mekka des feinen Uhrenbaus.

 weiter
weiter
Für weitere Informationen wende Dich bitte an :
Marcus Angebauer

|
![]()
